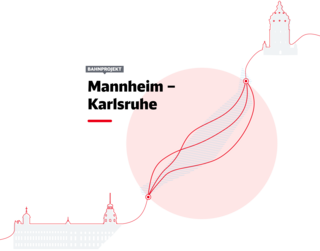Menü
- Stadt & Rathaus
- Bildung & Soziales
- Umwelt & Klima
- Kultur & Freizeit
- Mobilität & Stadtbild
- Wirtschaft & Wissenschaft
eService – Ihr Anliegen bequem Online erledigen
-
Wohnsitz elektronisch anmelden
-
Wohnsitz - Einzugstermin bestätigen
-
Meldebescheinigung
-
Online-Zulassung über i-Kfz
-
Online-Abmeldung über i-Kfz
-
Wunschkennzeichen beantragen oder reservieren
-
Aufenthaltserlaubnis
-
Urkundenbestellung
-
Sperrmüll – Abholtermin vereinbaren
-
Weiße Ware Abholtermin
-
Online-Termine
-
Weitere Services