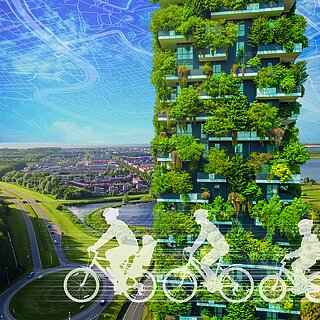Wenn das smarte Haus zum Alptraum wird
Philosoph Florian Rötzer referiert über das Wohnen mit Künstlicher Intelligenz und dessen Gefahren
Mit der „schönen neuen Welt“ des Wohnens in Smart Citys, komplett vernetzt mit der Welt, gesteuert von Künstlicher Intelligenz (KI) hat sich am Mittwoch der Journalist und Philosoph Florian Rötzer in der Stadtbibliothek beschäftigt. Dort stellte er auch sein neues Buch „Sein und Wohnen“ vor. Der 69-Jährige unternahm eine philosophische Reise durch die Kulturgeschichte und Bedeutung des Wohnens und wagte einen Ausblick in die Zukunft, die auch Gefahren mit sich bringt.
Noch stehe Chat GPT – also die Möglichkeit, mit Computern über Texteingabe menschenähnlich zu kommunizieren, wobei der Chatbot aus der Unterhaltung lernt – noch ganz am Anfang. Technologien würden heutzutage im häuslichen Bereich vorwiegend dafür benutzt, um ferngesteuert Rasensprenger zu aktivieren, Alarmanlagen zu bedienen oder Licht ein- und auszuschalten. „Alexa oder Siri sind noch deutlich dümmer als GPT. Wir sind erst am Anfang. Es wird eine Revolution des Wohnens mit der Digitalisierung einhergehen“, prognostizierte Rötzer. Es könnte das Unheimliche in die neue Häuslichkeit des Hightech-Hauses einziehen.
Die romantisierte Vorstellung eines Spukhauses formulierte einst ein altes Schloss oder verlassenes Haus, mit klappernden Fensterläden und finsteren Ecken. „Die Zukunft eines Spukhauses könnte ziemlich clean sein, spiegelnde Böden, sehr funktional. Der Einwohner könnte dort wie ein Gast oder Passagier auf einem Flughafen leben.“ Und all die schönen Dinge, die das Leben leichter machen sollen, könnten sich gegen die Bewohner richten. Kameras an der Haustür oder andere Objekte der vernetzten Welt könnten gehackt und von digitalen Eindringlingen übernommen werden und zu feindlichen System mutieren.
„Der private Raum könnte auch zum Gefängnis werden, das Smarthouse zur Falle“, spekulierte der Autor aus dem bayerischen Landshut. Datenauslese (siehe Alexa) könnte Spionieren im eigenen Haus ermöglichen. „Wir sind in unserer bürgerlichen Privatheit nicht mehr allein“, so der Ex-Chefredakteur des Online-Magazins „Telepolis“. Lernende KI-Systeme könnten womöglich nicht nur eloquent kommunizieren, sondern aus Gesichtern lesen und Gefühle wie Liebe oder Hass simulieren und eventuell sogar eigene Zwecke verfolgen. Fast wähnte man sich ein wenig an den Science-Fiction-Klassiker aus den 70er Jahren, „Westworld, erinnert, in dem menschenähnliche Roboter in einem historisierenden Freizeitpark gegen ihre Schöpfer und Benutzer rebellieren.
In Zeiten lernender komplexer Systeme wachse auch die Abhängigkeit von Experten, so Rötzer. Im Dialog mit dem Auditorium der gut besuchen Veranstaltung, die als Teil des Karlsruher Forums für Kultur, Recht und Technik stattfand, gab es viele gedankliche Ansätze. Einer meinte, dass das, was wir jetzt als KI entdecken, nur die Spitze des Eisbergs sei. Über Smart Citys, die im asiatischen Raum schon Realität sind, und Haftungsfragen, wenn die ganze Technologie mal durchdreht, wurde ebenfalls diskutiert. Auch die soziale Kontrolle der Menschen war ein Thema. In China könnten Menschen aufgrund der hohen Dichte von Überwachungs-Kameras bereits durch das ganze Land optisch verfolgt werden.
In Sachen Video-Überwachung wurde über Kameras gesprochen, die aufgrund von KI sozial unerwünschtes Verhalten in der Öffentlichkeit „dechiffrieren“. So könne die Software beispielsweise erkennen, wenn sich ein Taschendiebstahl oder Schlägerei anbahnt, sodass die Polizei präventiv eingreifen kann. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) erinnerte bei der Lesung daran, dass KI und Algorithmen eben das Ergebnis davon seien, was der Mensch der Maschine eingebe.
Volker Knopf